Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Das Urteil des OLG Koblenz im Detail
- Was bedeutet dieses Urteil für Sie? Praktische Relevanz
- Hintergrund: Die Berufsunfähigkeitsversicherung verstehen
- Fazit: Ein Urteil mit Signalwirkung
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Berufsunfähigkeit im juristischen Sinne genau?
- Welche Rolle spielen medizinische Gutachten bei der Feststellung von Berufsunfähigkeit?
- Kann ich Berufsunfähigkeitsleistungen erhalten, auch wenn meine Diagnose unklar oder umstritten ist?
- Was kann ich tun, wenn meine Berufsunfähigkeitsversicherung meinen Antrag ablehnt?
- Ab welchem Zeitpunkt erhalte ich Leistungen, wenn meine Berufsunfähigkeit festgestellt wurde?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 10 U 258/22 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht Koblenz
- Datum: 09.10.2024
- Aktenzeichen: 10 U 258/22
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Eine selbstständige Friseurin, die Leistungen aus ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung aufgrund einer chronischen Erkrankung forderte und darauf klagte.
- Beklagte: Die Versicherung, die die geforderten Leistungen ablehnte und gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung einlegte.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Eine selbstständige Friseurin beantragte bei ihrer Versicherung Leistungen wegen Berufsunfähigkeit seit November 2015 aufgrund einer Wirbelsäulenerkrankung. Die Versicherung lehnte den Antrag ab, woraufhin die Friseurin Klage erhob.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging um die Frage, ob die Klägerin im Sinne der Versicherungsbedingungen berufsunfähig war, ab welchem Zeitpunkt ein Anspruch auf Leistungen bestand und in welchem Umfang diese zu zahlen waren.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Gericht sprach der Klägerin rückständige Renten und Prämienzahlungen sowie laufende monatliche Renten bis Ende 2026 zu und stellte die Prämienzahlungspflicht bis dahin fest. Die Klage für den Zeitraum vor Dezember 2017 wurde abgewiesen.
- Begründung: Das Gericht stellte fest, dass die Klägerin seit November 2017 zu mindestens 50% berufsunfähig ist, was durch Sachverständigengutachten gestützt wurde. Gemäß den Versicherungsbedingungen begann der Anspruch auf Leistungen im Monat nach Eintritt der Berufsunfähigkeit, also ab Dezember 2017.
Der Fall vor Gericht
Chronische Wirbelsäulenschmerzen: Friseurin erstreitet Berufsunfähigkeitsrente vor Gericht

Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz zeigt: Auch wenn die genaue medizinische Diagnose umstritten ist, kann ein Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente bestehen. Entscheidend sind die nachweisbaren Auswirkungen der Erkrankung auf die Berufsausübung. Der Fall einer selbstständigen Friseurin verdeutlicht die Hürden, aber auch die Möglichkeiten für Betroffene.
Viele Menschen sichern sich für den Fall ab, dass sie ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) soll dann finanziell einspringen. Doch was passiert, wenn die Versicherung die Leistung verweigert? Ein aktueller Fall vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz beleuchtet genau diese Situation und klärt wichtige Fragen rund um ärztliche Gutachten und den genauen Zeitpunkt des Leistungsanspruchs. Dieses Urteil ist besonders relevant für Menschen, die aufgrund von chronischen Erkrankungen, insbesondere des Bewegungsapparates, um ihre berufliche Existenz kämpfen.
Das Urteil des OLG Koblenz im Detail
Das Oberlandesgericht Koblenz musste sich intensiv mit dem Fall einer selbstständigen Friseurin auseinandersetzen, die aufgrund einer schweren Wirbelsäulenerkrankung nicht mehr arbeiten konnte. Im Kern ging es darum, ob und ab wann ihr Leistungen aus ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung zustehen.
Worum ging es im Kern? Der Fall der Friseurin
Die Klägerin, eine engagierte Friseurin, betrieb ihren eigenen Salon ohne Angestellte. Ihr Alltag war geprägt von langen Arbeitstagen: acht bis neun Stunden, fünf bis sechs Tage die Woche. Im Dezember 2015 beantragte sie bei ihrer Versicherung Leistungen aus ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie gab an, bereits seit November 2015 aufgrund starker gesundheitlicher Probleme berufsunfähig zu sein. Als Ursachen nannte sie eine Spondyloarthritis (eine entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule und Gelenke), eine bilaterale ISG Arthritis und Sakroiliitis (Entzündungen der Kreuzdarmbeingelenke) sowie allergisches Asthma.
Ihre Beschwerden waren massiv: Starke Schmerzen beim Stehen und Sitzen sowie erhebliche Bewegungseinschränkungen in Armen und Beinen machten ihr die Arbeit zur Qual. Sie konnte nach eigenen Angaben nur noch maximal zwei bis drei Stunden täglich arbeiten – viel zu wenig für die Führung ihres Salons. Die beklagte Versicherung sah das anders. Sie lehnte den Antrag im August 2016 und auch danach wiederholt ab. Die Begründung: Die geltend gemachten Einschränkungen seien nicht ausreichend nachgewiesen.
Die Friseurin ließ sich nicht entmutigen und zog vor Gericht. Sie forderte rückständige Rentenzahlungen seit November 2015, zukünftige monatliche Renten und die Befreiung von den Versicherungsbeiträgen. Das Landgericht Koblenz gab ihr nach Einholung eines orthopädischen Gutachtens teilweise Recht und sprach ihr Leistungen ab November 2017 zu. Doch die Versicherung legte Berufung ein, womit der Fall vor dem OLG Koblenz landete.
Die strittigen Punkte: Die zentralen Rechtsfragen
Vor dem OLG Koblenz mussten mehrere komplexe juristische und medizinische Fragen geklärt werden:
- Liegt tatsächlich eine Berufsunfähigkeit vor? Die Versicherungsbedingungen (hier die AVB BUV Stand Januar 2008) definieren genau, wann eine Berufsunfähigkeit gegeben ist. In der Regel bedeutet dies, dass die versicherte Person ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, voraussichtlich auf Dauer (meist mindestens sechs Monate) zu mindestens 50 % nicht mehr ausüben kann.
- Ab welchem Zeitpunkt begann die Berufsunfähigkeit? Dies ist entscheidend für den Beginn der Rentenzahlungen und der Beitragsfreistellung.
- Welche Erkrankung ist ursächlich und wie ist sie zu bewerten? Die Versicherung zweifelte die Diagnose Spondyloarthritis an und kritisierte, dass das Erstgutachten von einem Orthopäden und nicht von einem Rheumatologen stammte, obwohl die Hauptdiagnose in dessen Fachgebiet fiel.
- Wie zuverlässig sind die ärztlichen Gutachten? Gutachten spielen in BU-Prozessen eine zentrale Rolle. Ihre Qualität und die Fachkompetenz des Gutachters sind oft Gegenstand von Auseinandersetzungen.
- Welche Gesetze und Vertragsbedingungen sind relevant? Neben den individuellen Versicherungsbedingungen sind auch allgemeine gesetzliche Regelungen, beispielsweise aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) für Zinsen, zu beachten.
Die Klärung dieser Fragen ist für Laien oft schwer nachzuvollziehen, da sie tief in medizinische Details und juristische Feinheiten eintauchen.
So hat das OLG Koblenz entschieden
Das OLG Koblenz änderte das Urteil des Landgerichts in einigen Punkten ab, bestätigte aber im Wesentlichen den Anspruch der Klägerin. Die Richter verurteilten die Versicherung zur Zahlung von insgesamt 165.667,87 Euro. Dieser Betrag setzt sich aus rückständigen Renten für den Zeitraum von Dezember 2017 bis September 2024 und überzahlten Versicherungsprämien zusammen.
Zusätzlich muss die Versicherung ab Oktober 2024 bis längstens zum 31. Dezember 2026 eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente von 2.000 Euro zahlen. Weiterhin stellte das Gericht fest, dass die Klägerin für die Dauer ihrer Berufsunfähigkeit, beginnend ab dem 1. Mai 2019 bis längstens zum 31. Dezember 2026, von der Zahlung der Versicherungsprämien befreit ist.
Für den Zeitraum vor Dezember 2017 wurde die Klage jedoch abgewiesen. Das bedeutet, dass die Friseurin für die ersten zwei Jahre ihrer geltend gemachten Berufsunfähigkeit keine Leistungen erhält.
Die Gründe für die Entscheidung: Die Logik der Richter
Die Entscheidungsgründe des OLG Koblenz sind aufschlussreich und zeigen, wie Gerichte in solchen Fällen vorgehen. Sie stützen sich maßgeblich auf die eingeholten Sachverständigengutachten und die genaue Auslegung der Versicherungsbedingungen.
1. Die medizinische Grundlage: Gutachten als Schlüssel
Ein zentraler Punkt in der Argumentation des Gerichts war die medizinische Bewertung des Gesundheitszustands der Klägerin. Da die ursprüngliche Diagnose (Spondyloarthritis) primär in das Fachgebiet der Rheumatologie fällt, hatte das OLG ein zusätzliches internistisch-rheumatologisches Gutachten von Dr. [I] eingeholt. Dies geschah, um sicherzustellen, dass der am besten geeignete Spezialist die medizinischen Fragen beurteilt – ein wichtiger Punkt, den die Versicherung in ihrer Berufung kritisiert hatte.
Der neue Gutachter, Dr. [I], bestätigte überzeugend, dass bei der Klägerin eine fortgeschrittene degenerative Wirbelsäulenerkrankung vorliegt. Anhand von bildgebenden Verfahren (z.B. Röntgen, MRT) und körperlichen Untersuchungen konnte er chronische Schmerzen und deutliche Bewegungseinschränkungen nachweisen. Dazu zählten eine Kyphose (Rundrücken) und Hyperlordose (Hohlkreuz) der Halswirbelsäule, eine Hyperlordose und Arthrose (Gelenkverschleiß) der Lendenwirbelsäule sowie ein eingeschränkter Finger-Boden-Abstand – ein Test, der die Beweglichkeit der Wirbelsäule misst. Diese Befunde stimmten im Wesentlichen mit denen des ersten Gutachters, Dr. [G], überein.
2. Der Knackpunkt Diagnose: Spondyloarthritis oder degenerative Erkrankung?
Interessanterweise kam der zweite Gutachter Dr. [I] zu einer anderen Hauptdiagnose als sein Vorgänger. Er ging nicht davon aus, dass eine Spondyloarthritis die Hauptursache für die Beschwerden ist. Seine Gründe:
- Die Klägerin war HLA-B27 negativ. HLA-B27 ist ein genetischer Marker, der bei 85-95 % der Patienten mit Spondyloarthritis nachweisbar ist. Sein Fehlen macht die Diagnose unwahrscheinlicher, schließt sie aber nicht völlig aus.
- Schmerzmittel aus der Gruppe der NSAID (nichtsteroidale Antirheumatika, z.B. Ibuprofen, Diclofenac) zeigten bei der Klägerin kaum Wirkung. Diese Medikamente sind oft sehr wirksam bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen wie der Spondyloarthritis.
- Bildgebende Verfahren zeigten eine Hyperostosis triangularis ilii, eine knöcherne Verdickung am Darmbein, die eher als Ausgangspunkt für degenerative (verschleißbedingte) Erkrankungen gilt.
Das Gericht folgte dieser Einschätzung von Dr. [I]. Entscheidend für den Versicherungsanspruch war jedoch nicht die exakte medizinische Bezeichnung der Krankheit. Das OLG betonte, dass es aus versicherungsrechtlicher Sicht darauf ankommt, dass die Klägerin aufgrund von Krankheit ihren Beruf nicht mehr ausüben kann – egal, ob die Ursache nun eine Spondyloarthritis oder eine degenerative Wirbelsäulenerkrankung ist. Beide Gutachter hatten übereinstimmend eine Berufsunfähigkeit von mindestens 50 % festgestellt.
3. Der entscheidende Zeitpunkt: Ab wann lag Berufsunfähigkeit vor?
Auch zur Frage, seit wann die Klägerin berufsunfähig ist, lieferte das Gutachten von Dr. [I] die Grundlage. Er legte den Beginn der Berufsunfähigkeit auf (spätestens) November 2017 fest. Ein früherer Zeitpunkt sei spekulativ gewesen. Für November 2017 gab es jedoch handfeste Belege, insbesondere einen Arztbericht der [H]-Klinik über einen Aufenthalt der Klägerin in diesem Monat.
Der Gutachter kam zu dem Schluss, dass es der Klägerin angesichts ihrer Schmerzen und Bewegungseinschränkungen (auch der Hände, was zu einem unvollständigen Handschluss führte) nicht mehr möglich und zumutbar war, die körperlich anstrengende Tätigkeit als Friseurin – die ständiges Stehen, eine dem Kunden zugewandte Haltung und präzise Handarbeit erfordert – länger als zwei bis drei Stunden täglich auszuüben. Damit war die erforderliche 50%-Grenze für die Berufsunfähigkeit klar überschritten.
Das Gericht schloss sich dieser Einschätzung vollumfänglich an. Gemäß den Versicherungsbedingungen (§ 5 Abs. 1 AVB BUV) entsteht der Anspruch auf Leistungen jedoch erst mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der Berufsunfähigkeit folgt. Da die Berufsunfähigkeit im November 2017 eintrat, konnte die Klägerin Leistungen (Rente und Beitragsfreistellung) somit erst ab Dezember 2017 beanspruchen. Dies war ein wichtiger Grund für die Abänderung des erstinstanzlichen Urteils, das Leistungen bereits ab November 2017 zugesprochen hatte.
4. Weitere Korrekturen und Details
Das OLG korrigierte auch einen Fehler im landgerichtlichen Urteil bezüglich des Leistungsende. Die Versicherung und die damit verbundene Leistungsdauer enden vertragsgemäß am 31. Dezember 2026 und nicht, wie zunächst vom Landgericht angegeben, am 1. Januar 2027.
Die Zinsansprüche auf die rückständigen Renten wurden ebenfalls detailliert geregelt, basierend auf den Paragraphen §§ 286 und 288 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die den Verzug und Verzugszinsen regeln. Die überzahlten Beiträge sind ab dem Zeitpunkt der Klageerhebung (Rechtshängigkeit) gemäß §§ 288, 291 BGB zu verzinsen.
Was bedeutet dieses Urteil für Sie? Praktische Relevanz
Dieses Urteil hat über den Einzelfall hinaus Bedeutung. Es verdeutlicht wichtige Aspekte im Umgang mit Berufsunfähigkeitsversicherungen und kann Betroffenen Orientierung geben.
Für wen ist dieses Urteil besonders wichtig?
Das Urteil ist von besonderem Interesse für:
- Personen mit Berufsunfähigkeitsversicherung: Es zeigt, dass auch bei komplexen Krankheitsbildern und strittigen Diagnosen ein Anspruch durchsetzbar ist.
- Menschen mit chronischen Wirbelsäulenerkrankungen oder ähnlichen Beschwerden: Es macht deutlich, dass nicht die exakte Diagnose, sondern die tatsächlichen funktionellen Einschränkungen im Beruf entscheidend sind.
- Selbstständige und Freiberufler: Der Fall illustriert die besondere Härte, wenn die eigene Arbeitskraft die Existenzgrundlage bildet und diese wegfällt.
- Versicherungsunternehmen: Das Urteil unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung und die Bedeutung fachlich fundierter Gutachten.
„Was heißt das für mich?“ – Konsequenzen im Alltag
Wenn Sie selbst von einer möglichen Berufsunfähigkeit betroffen sind oder eine BU-Versicherung haben, können Sie aus diesem Urteil einige Schlüsse ziehen:
- Genaue Dokumentation ist entscheidend: Sammeln Sie alle Arztberichte, Befunde und Nachweise über Ihre gesundheitlichen Einschränkungen und deren Auswirkungen auf Ihre berufliche Tätigkeit.
- Die Wahl des richtigen Gutachters kann wichtig sein: Bestehen Sie gegebenenfalls darauf, dass ein Sachverständiger mit der passenden Spezialisierung für Ihre Haupterkrankung hinzugezogen wird.
- Lassen Sie sich nicht vorschnell entmutigen: Auch wenn Ihre Versicherung Leistungen zunächst ablehnt, kann es sich lohnen, den Anspruch weiterzuverfolgen und juristischen Rat einzuholen.
- Verstehen Sie Ihre Versicherungsbedingungen: Informieren Sie sich genau, was in Ihrem Vertrag unter Berufsunfähigkeit verstanden wird und welche Voraussetzungen für Leistungen gelten (z.B. Wartezeiten, Leistungsbeginn).
- Fokus auf funktionelle Einschränkungen: Argumentieren Sie nicht nur mit Diagnosen, sondern vor allem damit, welche konkreten Tätigkeiten Ihres Berufs Sie aufgrund Ihrer Erkrankung nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt ausüben können.
Wichtig: Dieser Artikel stellt keine Rechtsberatung dar, sondern dient der allgemeinen Information. Im konkreten Einzelfall sollten Sie immer den Rat eines spezialisierten Rechtsanwalts einholen.
Blick zurück, Blick nach vorn: Die Rechtslage im Wandel?
Das Urteil des OLG Koblenz erfindet das Recht der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht neu, aber es bestätigt und präzisiert wichtige Grundsätze. Es unterstreicht die Beweislast des Versicherten, der nachweisen muss, dass er berufsunfähig ist. Gleichzeitig zeigt es, dass Gerichte die Argumente und Gutachten sehr genau prüfen und nicht allein auf die von der Versicherung favorisierte medizinische Einschätzung abstellen. Die Betonung, dass die tatsächlichen Auswirkungen der Krankheit auf die Berufsausübung zählen und nicht primär die exakte Diagnose, ist ein wichtiger Punkt für viele Betroffene, deren Leiden oft schwer in klare diagnostische Schubladen passen.
Hintergrund: Die Berufsunfähigkeitsversicherung verstehen
Um die Tragweite solcher Urteile einordnen zu können, ist ein grundlegendes Verständnis der Berufsunfähigkeitsversicherung hilfreich.
Das Rechtsgebiet: Was ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV) ist eine private Versicherung, die dann leistet, wenn die versicherte Person ihren zuletzt ausgeübten Beruf infolge von Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall voraussichtlich auf Dauer (in der Regel für mindestens sechs Monate) zu einem bestimmten Grad (meist mindestens 50 %) nicht mehr ausüben kann. Die genauen Bedingungen sind in den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) des Vertrags festgelegt.
Ziel der BUV ist es, den Einkommensverlust abzufedern, der durch den Wegfall der Arbeitskraft entsteht. Die Leistungen bestehen typischerweise aus einer monatlichen Rente und oft auch aus der Befreiung von der weiteren Beitragszahlungspflicht für die Dauer der Berufsunfähigkeit.
Typische Streitpunkte und die Rolle von Gutachten
Konflikte mit der BU-Versicherung entstehen häufig um folgende Punkte:
- Grad der Berufsunfähigkeit: Erreicht die Einschränkung tatsächlich die im Vertrag geforderten 50 %?
- Prognose der Dauerhaftigkeit: Ist die Berufsunfähigkeit nur vorübergehend oder voraussichtlich dauerhaft (mind. 6 Monate)?
- Ursächlichkeit: Sind die geltend gemachten Beschwerden tatsächlich auf eine Krankheit im Sinne der Bedingungen zurückzuführen?
- Medizinische Bewertung: Hier spielen ärztliche Gutachten eine entscheidende Rolle. Oft werden von beiden Seiten – Versicherer und Versicherter – Gutachten vorgelegt oder von Gerichten eingeholt. Die Auswahl des Gutachters, dessen Fachrichtung und die Methodik seiner Untersuchung können den Ausgang eines Verfahrens maßgeblich beeinflussen.
Wie der Fall der Friseurin zeigt, sind gerade die medizinischen Gutachten oft der Dreh- und Angelpunkt. Gerichte müssen dann entscheiden, welchem Gutachten sie folgen oder ob, wie hier geschehen, ein weiteres Gutachten eingeholt werden muss.
Fazit: Ein Urteil mit Signalwirkung
Das Urteil des OLG Koblenz (Az: 10 U 258/22) ist ein gutes Beispiel dafür, wie komplex Auseinandersetzungen um Berufsunfähigkeitsleistungen sein können. Es zeigt aber auch, dass Betroffene mit fundierter Argumentation und stichhaltigen medizinischen Nachweisen erfolgreich um ihr Recht kämpfen können. Die Entscheidung stärkt die Position von Versicherten, deren Berufsunfähigkeit auf schwer objektivierbaren, aber realen Beschwerden wie chronischen Schmerzen beruht. Sie unterstreicht, dass am Ende die tatsächliche Einschränkung der beruflichen Leistungsfähigkeit zählt – auch wenn der genaue medizinische Name der Krankheit unter Experten diskutiert wird.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil verdeutlicht, dass für den Anspruch auf Berufsunfähigkeitsleistungen nicht die exakte medizinische Diagnose entscheidend ist, sondern die tatsächlichen funktionellen Einschränkungen im Beruf. Auch bei komplexen oder strittigen Erkrankungsbildern kann ein Leistungsanspruch bestehen, wenn nachweisbar ist, dass die betroffene Person ihren Beruf zu mindestens 50% nicht mehr ausüben kann. Für Betroffene ist eine genaue Dokumentation aller medizinischen Befunde und der konkreten beruflichen Einschränkungen besonders wichtig, um ihre Ansprüche durchzusetzen.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.
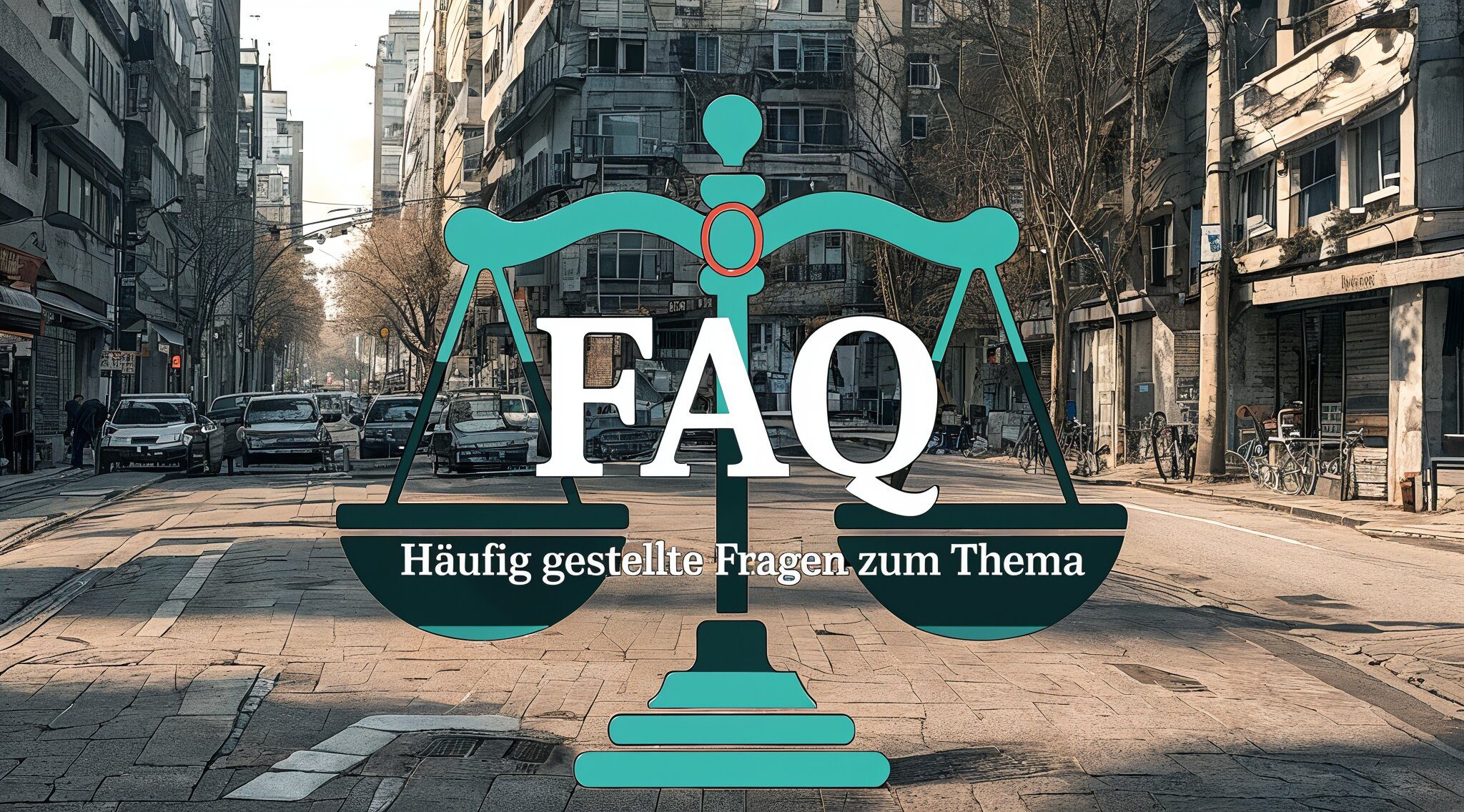
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet Berufsunfähigkeit im juristischen Sinne genau?
Wenn im juristischen Sinne von Berufsunfähigkeit die Rede ist, geht es nicht darum, ob Sie überhaupt keine Tätigkeit mehr ausüben können. Vielmehr bedeutet Berufsunfähigkeit nach der Definition in den meisten Versicherungsbedingungen, dass Sie Ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie Sie ihn konkret gestaltet und ausgeübt haben, voraussichtlich dauerhaft nicht mehr oder nur noch zu einem bestimmten Mindestanteil (oft 50%) ausüben können.
Es kommt also darauf an, welche Tätigkeiten genau zu Ihrem Arbeitsalltag gehörten. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Handwerker vor, der täglich schwere Dinge heben musste. Kann er diese spezifische körperliche Anforderung aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr erfüllen, könnte dies eine Berufsunfähigkeit für seinen konkreten Beruf bedeuten – auch wenn er vielleicht noch leichtere Bürotätigkeiten ausüben könnte. Für einen Büroangestellten, dessen Job hauptsächlich aus Computerarbeit besteht, wären andere Einschränkungen relevant.
Die genauen Kriterien für Berufsunfähigkeit sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) Ihres Versicherungsvertrages festgelegt. Dort steht, unter welchen Voraussetzungen die Versicherung leistet. Oft ist dort eine Prozentgrenze genannt, ab der Sie als berufsunfähig gelten (z.B. 50%ige Unfähigkeit, den Beruf auszuüben).
Wichtig ist auch, dass in manchen (älteren oder ungünstigeren) Versicherungsverträgen eine sogenannte Verweisungsklausel enthalten sein kann. Diese erlaubt der Versicherung unter Umständen, Sie darauf zu verweisen, dass Sie trotz Ihrer Einschränkungen noch einen anderen Beruf ausüben könnten, der Ihren bisherigen Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht und Ihrer bisherigen Lebensstellung gleichwertig ist. Hochwertige Verträge verzichten oft auf diese Möglichkeit oder schränken sie stark ein.
Für Sie bedeutet das: Es ist nicht einfach die Frage „Kann ich noch arbeiten?“, sondern „Kann ich meinen Job so, wie ich ihn bisher gemacht habe, noch ausüben?“ und „Was genau steht dazu in meinem Versicherungsvertrag?“.
Welche Rolle spielen medizinische Gutachten bei der Feststellung von Berufsunfähigkeit?
Bei der Beurteilung, ob jemand berufsunfähig ist, spielen medizinische Gutachten eine sehr wichtige Rolle. Sie sind ein zentrales Beweismittel.
Ein medizinisches Gutachten dient dazu, Ihre gesundheitliche Situation objektiv zu beurteilen. Ein Arzt, der oft ein Spezialist für das betreffende Krankheitsbild ist, untersucht Sie und wertet Ihre medizinischen Unterlagen aus. Auf dieser Grundlage erstellt er eine Einschätzung, inwieweit Ihre Erkrankung oder Verletzung Ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt.
Der Gutachter bewertet dann, wie sich diese Beeinträchtigungen auf Ihre konkreten beruflichen Tätigkeiten auswirken. Kann jemand beispielsweise wegen starker Rückenschmerzen nicht mehr schwer heben, ist das für einen Bauarbeiter anders zu bewerten als für einen Büromitarbeiter. Das Gutachten hilft der Versicherung – und gegebenenfalls später einem Gericht –, das medizinische Ausmaß Ihrer Einschränkungen zu verstehen.
Wichtig ist jedoch: Ein Gutachten ist nicht das alleinige Kriterium für die Entscheidung über Berufsunfähigkeit. Die Versicherung oder ein Gericht betrachtet das Gesamtbild. Dazu gehören neben dem Gutachten auch alle anderen vorliegenden medizinischen Berichte, Ihre Beschreibung Ihrer täglichen Arbeit und Ihrer Einschränkungen sowie gegebenenfalls weitere Informationen. Das Gutachten ist ein Puzzleteil, wenn auch ein sehr bedeutendes.
Entscheidend für den Wert eines Gutachtens sind die Qualifikation und das Fachgebiet des Gutachters. Er sollte Erfahrung mit dem betreffenden Krankheitsbild haben. Ebenso wichtig ist die Nachvollziehbarkeit des Gutachtens. Das bedeutet, dass der Gutachter seine Feststellungen und Schlussfolgerungen klar und verständlich begründen muss. Es sollte für Sie erkennbar sein, auf welchen medizinischen Befunden das Ergebnis basiert.
Als Versicherter haben Sie das Recht, das Gutachten zu erhalten und zu überprüfen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Gutachten Ihre Situation nicht richtig wiedergibt, Befunde falsch interpretiert wurden oder wichtige Aspekte Ihrer Erkrankung nicht berücksichtigt sind, können Sie Einwände erheben. Sie haben auch die Möglichkeit, eigene medizinische Unterlagen oder die Befunde Ihrer behandelnden Ärzte vorzulegen, um Ihre Sichtweise zu unterstützen. In bestimmten Fällen kann auch ein eigenes Gutachten von einem Arzt Ihres Vertrauens erstellt werden, um eine Gegenposition darzulegen.
Kann ich Berufsunfähigkeitsleistungen erhalten, auch wenn meine Diagnose unklar oder umstritten ist?
Für den Anspruch auf Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung kommt es in erster Linie darauf an, wie stark Ihre gesundheitlichen Probleme Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Ihren Beruf auszuüben. Der Name der Krankheit oder eine exakte, von allen Ärzten gleichermaßen bestätigte Diagnose ist dabei oft nicht der alleinige entscheidende Punkt.
Wichtig ist vielmehr, welche konkreten körperlichen oder psychischen Einschränkungen aus Ihren gesundheitlichen Beschwerden folgen und wie diese sich auf Ihre alltägliche Arbeit auswirken. Zum Beispiel: Können Sie bestimmte Tätigkeiten, die für Ihren Beruf typisch sind, nicht mehr ausführen? Wie lange und in welchem Umfang können Sie noch arbeiten?
Es zählt also weniger das „Etikett“ der Erkrankung, sondern die messbaren Auswirkungen auf Ihre Arbeitskraft. Auch wenn eine Diagnose noch nicht endgültig feststeht oder verschiedene Ärzte unterschiedliche Meinungen haben, können Sie unter Umständen berufsunfähig sein, wenn die vorhandenen Symptome und deren Folgen Sie objektiv an der Ausübung Ihrer Tätigkeit hindern.
Sie als Versicherte Person haben allerdings die Pflicht, diese Einschränkungen und deren Auswirkungen auf Ihre Berufsfähigkeit gegenüber der Versicherung nachzuweisen. Dazu sind in der Regel ärztliche Unterlagen, Gutachten und detaillierte Beschreibungen Ihres Arbeitsplatzes und Ihrer Tätigkeiten erforderlich. Es ist wichtig, dass diese Nachweise die tatsächlichen funktionellen Beeinträchtigungen klar und verständlich darlegen.
Was kann ich tun, wenn meine Berufsunfähigkeitsversicherung meinen Antrag ablehnt?
Wenn Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) Ihren Antrag auf Leistungen ablehnt, ist das oft eine schwierige und belastende Situation. Es ist wichtig zu wissen, dass eine Ablehnung nicht zwangsläufig das Ende bedeutet. Die Versicherung muss Ihnen die Gründe für die Ablehnung schriftlich mitteilen. Diese Begründung ist der Ausgangspunkt für alle weiteren Überlegungen.
Typische Gründe für eine Ablehnung können in der medizinischen Beurteilung Ihrer Gesundheit liegen oder darin, dass die Versicherung die Definition der Berufsunfähigkeit nach ihren spezifischen Vertragsbedingungen anders beurteilt als Sie. Berufsunfähigkeit bedeutet in der Regel, dass Sie Ihren zuletzt ausgeübten Beruf aufgrund von Krankheit oder Unfall für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr zu einem bestimmten Prozentsatz (oft 50%) ausüben können.
Der erste und wichtigste Schritt ist, das Ablehnungsschreiben Ihrer Versicherung sehr sorgfältig zu prüfen und die darin genannten Gründe genau zu verstehen.
Nach der Prüfung des Schreibens gibt es grundsätzlich Wege, die Entscheidung der Versicherung überprüfen zu lassen:
Ein möglicher Weg ist die interne Überprüfung durch die Versicherung selbst. Sie können der Versicherung zusätzliche medizinische Unterlagen, Gutachten oder andere wichtige Informationen zukommen lassen, die Ihre Situation aus Ihrer Sicht besser darstellen und die Ablehnung möglicherweise entkräften können. Ziel ist hierbei oft, die Versicherung zu überzeugen, ihre Entscheidung außerhalb eines Gerichtsverfahrens zu ändern.
Führt auch eine solche interne Klärung nicht dazu, dass die Versicherung die Leistungen bewilligt, kann der nächste Schritt darin bestehen, die Angelegenheit gerichtlich klären zu lassen. Das bedeutet, dass ein unabhängiges Gericht den Fall prüft und entscheidet, ob die Ablehnung durch die Versicherung nach den vertraglichen und gesetzlichen Regelungen rechtmäßig war.
Bei all diesen Schritten sind wichtige Fristen zu beachten. Sowohl für die Kommunikation mit der Versicherung nach Erhalt des Ablehnungsschreibens als auch für das Einleiten rechtlicher Schritte gibt es bestimmte Zeiträume, die unbedingt eingehalten werden müssen. Das Verpassen einer Frist kann dazu führen, dass Sie Ihre Ansprüche nicht mehr durchsetzen können.
Die Prüfung einer Ablehnung durch die BU-Versicherung ist oft komplex. Sie erfordert ein tiefes Verständnis sowohl der spezifischen Versicherungsbedingungen Ihres Vertrages als auch der relevanten medizinischen Zusammenhänge und deren rechtlicher Bewertung.
Ab welchem Zeitpunkt erhalte ich Leistungen, wenn meine Berufsunfähigkeit festgestellt wurde?
Wenn Ihre Berufsunfähigkeit von der Versicherung anerkannt wurde, stellt sich die Frage, ab wann genau Sie Geldzahlungen erhalten. Der Leistungsbeginn ist in der Regel genau in Ihrem Versicherungsvertrag festgelegt.
Typischerweise sehen die Bedingungen vor, dass die Leistungen ab dem Zeitpunkt gezahlt werden, zu dem die Berufsunfähigkeit tatsächlich eingetreten ist, also begonnen hat. Das ist oft ein anderer Zeitpunkt als das Datum, an dem die Versicherung Ihren Antrag bearbeitet oder die Berufsunfähigkeit offiziell anerkannt hat.
Stellen Sie sich vor, Sie sind seit drei Monaten wegen einer Krankheit nicht mehr in der Lage, Ihren Beruf auszuüben. Sie stellen den Antrag bei Ihrer Versicherung, und nach einiger Bearbeitungszeit erkennt die Versicherung die Berufsunfähigkeit an. Oft erhalten Sie dann die Leistungen rückwirkend für die Zeit ab dem tatsächlichen Beginn Ihrer Berufsunfähigkeit (also für die drei Monate), sofern die Voraussetzungen erfüllt waren und Sie die Versicherung informiert haben.
Worauf es ankommt
- Der Versicherungsvertrag: Ihre individuellen Vertragsbedingungen sind entscheidend. Dort steht genau, wann die Leistungen beginnen. Manchmal gibt es auch eine kurze Wartezeit nach Vertragsabschluss, bevor Leistungen gezahlt werden können, aber das betrifft meist nicht den Zeitpunkt nach Eintritt der Berufsunfähigkeit.
- Zeitpunkt des Eintritts: Wichtig ist das Datum, an dem Sie tatsächlich berufsunfähig wurden, nicht unbedingt das Datum der Antragstellung oder der Anerkennung durch die Versicherung.
- Dokumentation: Es ist hilfreich, den genauen Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit durch ärztliche Atteste oder andere Unterlagen belegen zu können. Dies kann für die Feststellung des Leistungsbeginns relevant sein.
Es ist also wichtig zu verstehen, dass die Zahlung nicht immer erst mit der Entscheidung der Versicherung beginnt, sondern oft auf den tatsächlichen Beginn Ihrer Beeinträchtigung zurückwirkt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Berufsunfähigkeit
Berufsunfähigkeit bedeutet, dass eine Person ihren zuletzt ausgeübten Beruf wegen Krankheit, Unfall oder körperlicher/geistiger Beeinträchtigung voraussichtlich dauerhaft (in der Regel mindestens sechs Monate) nicht mehr oder nur noch zu einem bestimmten Mindestmaß (meist 50 %) ausüben kann. Entscheidend ist, wie der Beruf konkret ausgestaltet war und welche Tätigkeiten dazugehören. Das heißt: Es geht nicht darum, ob man grundsätzlich irgendeine Arbeit verrichten kann, sondern ob man den eigenen Beruf so ausüben kann wie zuvor.
Beispiel: Ein Friseur, der wegen starker Rückenschmerzen nicht mehr längere Zeit stehen oder präzise schneiden kann, gilt als berufsunfähig, selbst wenn er noch einfache Bürotätigkeiten ausüben könnte.
Allgemeine Versicherungsbedingungen Berufsunfähigkeitsversicherung (AVB BUV)
Die AVB BUV sind die Vertragsregeln, die festlegen, wann und unter welchen Voraussetzungen die Berufsunfähigkeitsversicherung Leistungen erbringt. Darin sind unter anderem definiert, was genau als Berufsunfähigkeit gilt, wie lange die Erkrankung voraussichtlich bestehen muss und ab wann Zahlungen erfolgen. Diese Bedingungen sind für die Entscheidung über Leistungsansprüche maßgeblich und können sich von Vertrag zu Vertrag unterscheiden.
Im vorliegenden Fall ist z. B. § 5 Abs. 1 AVB BUV entscheidend, der regelt, dass die Leistung ab dem Monat geleistet wird, der auf den Eintritt der Berufsunfähigkeit folgt.
Ärztliches Gutachten
Ein ärztliches Gutachten ist ein schriftliches Gutachten eines Mediziners, der anhand von Untersuchungen, Testergebnissen und Untersuchungsunterlagen die gesundheitliche Situation beurteilt. Im Berufsunfähigkeitsfall bewertet ein Gutachter, wie stark die Krankheit die Fähigkeit einschränkt, den zuletzt ausgeübten Beruf auszuüben. Die Qualifikation des Gutachters (z. B. Orthopäde oder Rheumatologe) und seine Fachkenntnis sind für die Aussagekraft wichtig.
Beispiel: Im Fall der Friseurin holte das Gericht ein internistisch-rheumatologisches Gutachten ein, um die Hauptursache ihrer Beschwerden fundiert beurteilen zu lassen.
Beweislast des Versicherten
Die Beweislast beschreibt die Verpflichtung, einen Anspruch zu begründen und nachzuweisen. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung liegt die Beweislast beim Versicherten, das heißt der oder die Versicherte muss nachweisen, dass die Berufsunfähigkeit tatsächlich besteht und die vertraglich geforderten Voraussetzungen erfüllt sind. Dieser Nachweis erfolgt z. B. durch ärztliche Berichte, Gutachten und sonstige medizinische Unterlagen.
Im Beispiel musste die Friseurin der Versicherung und dem Gericht anhand von Gutachten und medizinischen Befunden zeigen, dass sie wegen ihrer Erkrankung nicht mehr in der Lage war, ihren Beruf mindestens zur Hälfte auszuüben.
Beitragsfreistellung
Die Beitragsfreistellung bedeutet, dass der Versicherte während der anerkannten Dauer der Berufsunfähigkeit von der Pflicht befreit ist, weiterhin die Versicherungsbeiträge zu zahlen. Die Versicherung bleibt aber bestehen und zahlt Leistungen aus. Diese Regelung stellt sicher, dass die versicherte Person nicht gleichzeitig keine Leistungen erhält und dennoch weiter Beiträge aufwenden muss.
Im Urteil wurde der Friseurin für den Zeitraum ihrer Berufsunfähigkeit eine Beitragsfreistellung ab dem 1. Mai 2019 bis zum 31. Dezember 2026 zugesprochen.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 172 VVG (Versicherungsvertragsgesetz): Regelt die Voraussetzungen für die Leistungsfreiheit der Versicherung bei Berufsunfähigkeit und definiert die Kriterien für den Leistungsanspruch. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht prüfte anhand der AVB und VVG, ob die Klägerin die Bedingungen für den Leistungsbezug erfüllt, insbesondere ob eine dauerhafte Berufsunfähigkeit von mindestens 50 % vorliegt.
- Allgemeine Versicherungsbedingungen Berufsunfähigkeit (AVB BUV, Stand Januar 2008): Legt die vertraglichen Voraussetzungen fest, wann eine Berufsunfähigkeit gilt, z. B. Mindestdauer (meist sechs Monate) und Ausmaß der Einschränkung (mindestens 50 %). | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Beurteilung begann mit der Frage, ob die Klägerin ihren Beruf als Friseurin mindestens zu 50 % nicht mehr ausüben konnte und ab wann die Berufsunfähigkeit medizinisch belegbar eintrat.
- § 286 BGB (Verzug) und § 288 BGB (Verzugszinsen): Regelt den Zahlungsverzug und die Verzinsung von Rückständen bei Versicherungsleistungen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Für die rückständigen Rentenzahlungen und überzahlten Versicherungsbeiträge wurden Verzugszinsen durch das Gericht berechnet und zugesprochen.
- Rechtsprechung zur Beweislast bei Berufsunfähigkeit: Der Versicherte muss die Berufsunfähigkeit und deren Auswirkungen auf die konkrete berufliche Tätigkeit beweisen; Gerichte bewerten die medizinischen Gutachten unter Berücksichtigung der functional disability statt der reinen Diagnose. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG prüfte sorgfältig die von beiden Seiten vorgelegten Gutachten und stellte fest, dass die funktionellen Einschränkungen trotz strittiger Diagnose eine Berufsunfähigkeit begründen.
- Medizinisches Sachverständigenrecht (Grundsatz der fachkompetenten Begutachtung): Rechtsgrundlage für die Einholung von spezialisierten Gutachten, die für die Beurteilung der Krankheit und deren Auswirkungen notwendig sind. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht ließ ein internistisch-rheumatologisches Spezialgutachten erstellen, weil die Erstdiagnose in diesem Fachbereich lag und die Versicherung das erste Gutachten in Frage stellte.
- Vertragsrechtliche Regelung zum Leistungsbeginn (§ 5 Abs. 1 AVB BUV): Leistungsverpflichtung beginnt frühestens mit dem Monat, der auf den Eintritt der Berufsunfähigkeit folgt. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Versicherungsanspruch begann rechtlich erst ab Dezember 2017, obwohl die Klägerin die Berufsunfähigkeit bereits ab November 2017 geltend machte.
Das vorliegende Urteil
OLG Koblenz – Az: 10 U 258/22 – Urteil vom 09.10.2024
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.







