LG Berlin, Az.: 7 S 26/10, Urteil vom 09.09.2010
1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Mitte vom 15.04.2010 – 6 C 73/09 – geändert: Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
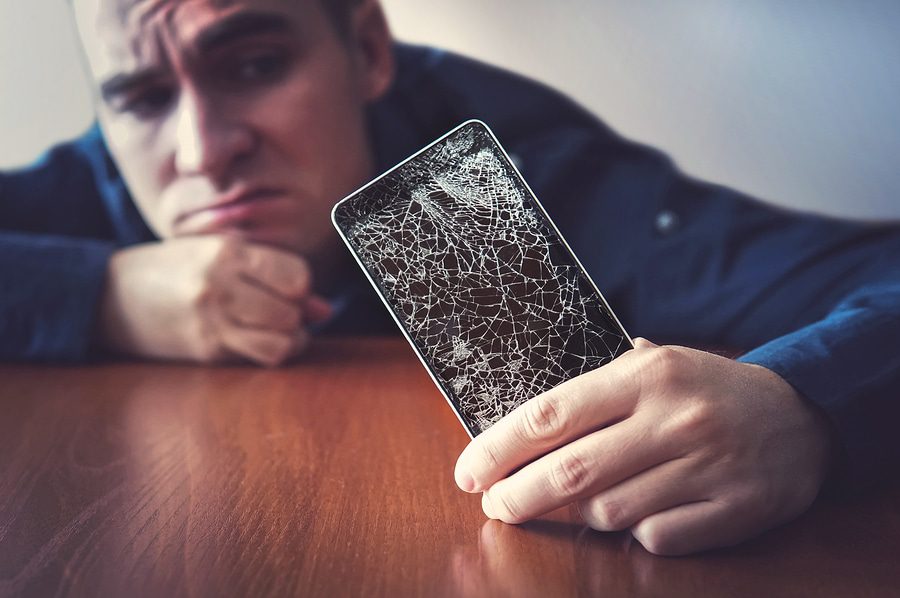
Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet. Die Feststellungen des Amtsgerichts tragen nicht seine Annahme, die Klägerin habe die Deckungsvoraussetzung gemäß § 2 Ziff. 5 c) AVB (Anlage K 8, Bl. 16 d. A.) erfüllt. Die nach der genannten Bestimmung von einem Versicherungsnehmer geforderte Voraussetzung, dass das Gerät „im persönlichen Gewahrsam sicher mitgeführt wurde“ verlangt einen gesteigerten persönlichen Gewahrsam insbesondere während der Zeit, in der er sich in der Öffentlichkeit aufhält oder fortbewegt, wobei das Maß des geforderten Sicherungsverhaltens vom Wert des Gegenstandes, der Intensität des Diebstahlanreizes sowie insbesondere auf dem Gefährdungsgrad der jeweiligen Örtlichkeit und Situation abhängt. Erforderlich ist, dass der Versicherungsnehmer den Gegenstand entsprechend seinem äußeren Wert und den äußeren Umständen der Gefährdung sichert und körpernah trägt oder hält, so dass die naheliegende Gefahren des Verlusts vermieden werden und er jederzeit bereit und in der Lage ist, einen möglichen Diebstahlsversuch abzuwehren (vgl. OLG Frankfurt, Urt. v. 15.01.2004 – 3 U 39/03 – VersR 2004, 1601, zitiert nach juris: Rz. 18; LG Saarbrücken, Urt. v. 23.12.1999 – 13 AS 83/99 – VersR 2000, 1235, zitiert nach juris; AG Köln, Urt. v. 12.10.2009 – 147 C 16/09 – zitiert nach juris: Rz. 7; Knappmann, in: Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl., § 1 AVBR 92 Rz. 24). Die Frage, ob hierfür ständiger Blick- oder Körperkontakt erforderlich ist oder nur die permanente Zugriffsmöglichkeit, hängt von der jeweiligen Reisephase ab (vgl. LG München, Urt. v. 13.12.1995 – 15 S 15448/95 – VersR 1996, 887, zitiert nach juris, zu § 1 Abs 4 Buchst b ReiseGepAVB 1980).
Einen derartigen versicherten Gewahrsam hat die Klägerin nicht vorgetragen. Er würde nach dem Gefährdungsgrad der Örtlichkeit in einer voll besetzten S-Bahn voraussetzen, dass die Klägerin einen körperlichen Kontakt zum Mobilfunktelefon oder zumindest zum Verschlussmechanismus der über die Schulter gehängten Handtasche hielt. Denn ohne diese Sicherung bestand die nahe liegende Gefahr, dass jemand unbemerkt von hinten den Reißverschluss der Handtasche öffnet und das Mobilfunktelefon herauszieht, ohne dass die Klägerin dies hätte sicher vermeiden können und ohne dass sie damit jederzeit bereit und in der Lage ist, einen möglichen Diebstahlsversuch abzuwehren.
Soweit die Klägerin dagegen geltend macht (vgl. Klageschrift, Seite 4), diese enge Auslegung würde den Versicherungsschutz entwerten, weil nur das persönliche In-der-Hand-Halten von versicherten Sache zum Versicherungsschutz führe, trifft dies nicht zu, da im Streitfall auch die Sicherung des Verschlussmechanismus (etwa durch Handauflegen oder durch jedes billige Zahlenschloss) gereicht hätte und da die gesteigerten Anforderungen im Streitfall auf einer offensichtlich gesteigerten Gefährdungslage (volle S-Bahn) beruhen und weil nach den Bedingungen eindeutig nur die sichere Mitführung versichert ist. Der Versicherungsschutz umfasst also gerade eindeutig und für den verständigen Versicherungsnehmer ersichtlich und von der einhelligen Rechtsprechung gebilligt gerade nicht den „normalen Fall des Diebstahls“ (vgl. Replik, Seite 4, Bl. 94 d.A.). Die Kammer hält entgegen der Auffassung der Klägerin (vgl. Schriftsatz v. 16.08.2010 – Stellungnahme, Seite 3, Bl. 168 d. A.) den Begriff der Sicherheit auch für eindeutig, auch soweit er zur situationsabhängigen Differenzierung zwingt. Auch die Klägerin wird kaum umgangssprachlich erklären wollen, sie habe das Gerät sicher während der S-Bahn-Fahrt verwahrt, wenn sie den entscheidenden Verschlussmechanismus gerade nicht gesichert hatte.
Die von der Klägerin gegen diese am Wortlaut orientierte und hiernach eindeutige Auslegung vorgebrachten Argumente greifen nicht durch. Zu Unrecht meint die Klägerin, aus der Höhe der Versicherungsprämie auf einen weitergehenden Versicherungsschutz schließen zu können (Stellungnahme, Seite 2, Bl. 167 d. A.). Abgesehen von grundsätzlichen Erwägungen steht einer solchen Überlegung schon entgegen, dass die Beklagte für die Prämie nicht nur das Risiko des Diebstahls versichert hat, sondern auch das Risiko von Sachschäden übernommen hat (vgl. § 2 der Bedingungen für die Schutzbriefe Technik, Anlage K 8, Bl. 16 d. A.).
Im Ergebnis stellt die maßgebende Deckungsvoraussetzung gemäß § 2 Ziff. 5 c) AVB im Streitfall auch keine überraschende und dadurch unwirksame (vgl. § 305c BGB) Entziehung des Versicherungsschutzes (im Sinne von Nr. 1 der Erwägungen in der mündlichen Verhandlung, Bl. 175 d. A.) dar noch führt sie zur erheblichen Abweichung von § 61 VVG a. F. (im Sinne von Nr. 2 der Erwägungen in der mündlichen Verhandlung, Bl. 175 d. A.). Denn es handelt sich bei der Diebstahlsversicherung nur um eine Annexversicherung zu einer eine Vielzahl von Gefahren abdeckenden Versicherungen (vgl. § 2 AVB). Die Klägerin hatte also nicht nur eine reine Diebstahlsversicherung abgeschlossen, deren Anwendungsbereich letztlich überraschend gering ausfiel bzw. abweichend von § 61 VVG a. F. ausgestaltet wurde. Vielmehr musste die Klägerin mit einer Qualifikation der Diebstahlsversicherung rechnen, schon weil auch der mitversicherte Einbruchsdiebstahl per se entsprechend qualifiziert war und der Versicherer daher den „ganz einfachen“ Diebstahl nicht mitversichern wollte.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.
Der Vollstreckbarkeitsausspruch folgt den §§ 708 Nr. 11, 711, 713 ZPO, Art. 26 Nr. 8 EGZPO.
Die Revision war nicht zuzulassen (vgl. § 543 Abs. 2 ZPO). Die Sache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Es um die Würdigung des Sachverhalts im Einzelfall. Die maßgeblichen Rechtsfragen sind vom Bundesgerichtshof geklärt. Das Gericht weist von dieser Rechtsprechung nicht ab. Zu einer Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gibt der Rechtsstreit keinen Anlass.







