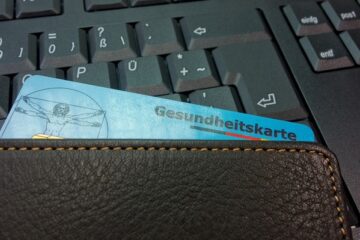OLG Frankfurt – Az.: 3 U 160/10 – Urteil vom 03.02.2011
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 27.05.2010 verkündete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main abgeändert.
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 58.798,93 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 08.07.2006 zu zahlen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen haben der Kläger 60% und die Beklagte 40% zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dem jeweiligen Vollstreckungsschuldner bleibt es nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abzuwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
Die Revision wird zugelassen.
Gründe
Der Kläger verlangt von der Beklagten Leistungen aus einer Unfallversicherung, die er im Jahr 2003 unter Zugrundelegung der AUB 99 und der UBB 201 abgeschlossen hatte. Am …3.2003 kugelte sich der Kläger bei einem Sturz von der Leiter den rechten Arm aus, was zu einer Läsion des Plexus brachialis, d.h. einer Schädigung des den Arm und die Hand versorgenden Nervengeflechts führte. Die Verletzungen des Klägers wurden in der Folgezeit von einer Vielzahl von Ärzten begutachtet.
Die Beklagte ging davon aus, dass die Funktionsfähigkeit des Arms nach Ablauf von drei Jahren zur Hälfte eingebüßt sei und zahlte dementsprechend 56.242,45 € an den Kläger.
Der Kläger behauptet eine völlige Funktionsunfähigkeit des Arms und begehrt mit der vorliegenden Klage den Differenzbetrag.
Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Beauftragung des Sachverständigen Dr. SV1. Dieser hat in seinem schriftlichen Gutachten eine Funktionsbeeinträchtigung des Arms von 11/20 angenommen und dies anlässlich der Erläuterung seines Gutachtens in der mündlichen Verhandlung dahin konkretisiert, die Beeinträchtigung im Bereich der Hand sei mit 80%, im Bereich des Unterarms mit 10% und im Bereich der Hand mit 80% zu gewichten. In dieser mündlichen Verhandlung hat das Landgericht sich die Verletzungsfolgen vom Kläger unter Einschaltung des Sachverständigen detailliert darstellen lassen.
Mit Urteil vom 27.05.2010, auf dessen tatsächliche Feststellungen im Übrigen Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Es ist dabei tatsächlich den Feststellungen des Sachverständigen in vollem Umfang gefolgt und hat durch eine Addition der Beeinträchtigung der Schulter (40% des vereinbarten Taxwerts 70% = 28% der vereinbarten Versicherungsleistung) und der Beeinträchtigung der Hand (80% des vereinbarten Taxwerts 55% = 44% der vereinbarten Versicherungsleistung) eine Gesamtversicherungsleistung von mehr als 70% angenommen.
Gegen dieses ihr am 09.06.2010 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 17.06.2010 Berufung eingelegt und diese am 05.08.2010 begründet.
Die Beklagte hält das vom Landgericht eingeholte Sachverständigengutachten wegen inhaltlicher Mängel und Bedenken an der Qualifikation des Sachverständigen für unverwertbar und hält es für erforderlich, ein neurologisches Gutachten einzuholen. Sie ist der Ansicht, eine Addition der Einzelwerte sei nicht möglich, die Funktionslogik der Gliedertaxe schließe bei Verlust eines funktionell höher bewerteten, dem Rumpf näheren Glieds den Verlust eines geringer bewerteten und dem Rumpf ferneren Glieds ein.
Die Beklagte erstrebt eine Abweisung der Klage, der Kläger verteidigt das angefochtene Urteil.
Der Kläger ist der Ansicht, der Umfang der Funktionsbeeinträchtigung seines Arms sei durch den gerichtlichen Sachverständigen erster Instanz tatsächlich hinreichend und zutreffend geklärt, der Einholung eines neurologischen Gutachtens bedürfe es nicht. Infolge der unklaren Fassung der Versicherungsbedingungen sei eine Addition der Einzelbeeinträchtigungen insbesondere möglich, wenn – wie bei ihm – ein Polytrauma vorliege.
Die Berufung ist zulässig, insbesondere an sich statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt und begründet, hat in der Sache indes nur zum Teil Erfolg. Der Kläger kann von der Beklagten aus dem Unfallversicherungsvertrag, in den die Beklagte als Rechtsnachfolgerin eingetreten ist, Zahlung einer Invaliditätsentschädigung in Höhe von insgesamt 58.798,93 € verlangen. Dies entspricht 15/20 des vereinbarten Armwerts oder 52,5% der vereinbarten Versicherungssumme unter Einbezug der vereinbarten Progressionsstaffel.
Ein dahingehender Anspruch steht ihm aus dem Unfallversicherungsvertrag i.V.m. § 1 VVG zu.
Unstreitig zwischen den Parteien ist, dass mit dem Unfall, den der Kläger am …03.2003 erlitt, der Versicherungsfall eingetreten ist.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist davon auszugehen, dass die Invalidität, die der Kläger infolge des Unfalls erlitt, mit 52,5% der Versicherungssumme zu bemessen ist.
Dies folgt aus den von den Parteien zum Vertragsinhalt gemachten Allgemeinen Bedingungen zur Unfallversicherung (AUB 88), die die Höhe der Leistung – in ihrem Anwendungsbereich unter regelmäßigem Ausschluss des Nachweises einer höheren oder geringeren Invalidität – nach dem Grad der Invalidität in Form einer sog. Gliedertaxe pauschaliert (§ 7 I. (2) a) AUB 88). Für Verlust oder Funktionsunfähigkeit der dort genannten Glieder ist jeweils ein fester Invaliditätsgrad zwischen 2 % und 70 % vereinbart, wobei dieser Grad mit Rumpfnähe des Teilgliedes jeweils steigt.
Aus dieser Gliedertaxe ist vorliegend der für einen „Arm im Schultergelenk“ vereinbarte Invaliditätsgrad von 70% der Versicherungssumme zugrunde zu legen und nach § 7 I. (2) b) AUB 88 auf 15/20 dieses Werts zu reduzieren, weil die Funktionsbeeinträchtigung des Arms bezogen auf einen Zeitpunkt von drei Jahren nach dem Unfall nur mit diesem Teil anzunehmen ist.
Dies steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme fest, die das Landgericht durchgeführt hat und an die der Senat gebunden ist, weil konkrete Anhaltspunkte für Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellungen nicht bestehen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
Zu Recht ist das Landgericht den Feststellungen des Sachverständigen Dr. SV1 gefolgt. Diese hat der Kläger sich ausdrücklich zu eigen gemacht, sie für richtig gehalten und eine weitere Beweiserhebung über diese Frage für nicht erforderlich gehalten. Die von der Beklagten an dem Gutachten geäußerten Bedenken vermögen dessen Beweiswert nicht zu erschüttern. Der Sachverständige hat den Kläger persönlich untersucht und hat in seine Begutachtung die vorher durchgeführten Untersuchungen, soweit diese schriftlich dokumentiert waren, miteinbezogen.
Er hat sich dabei erkennbar und nachvollziehbar bemüht, den für die Beurteilung vereinbarten Zeitpunkt drei Jahre nach dem Unfall zu rekonstruieren
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Sachverständige nicht zu widersprüchlichen Ergebnissen gekommen, hat insbesondere nicht im Rahmen seiner Anhörung im Termin zur mündlichen Verhandlung den Umfang der eingetretenen Invalidität anders bewertet als zuvor in seinem schriftlichen Gutachten. In dem Gutachten hat der Sachverständige die Beeinträchtigung des Arms mit 11/20 angenommen. Hiervon ist in seiner Anhörung in keiner Form abgerückt, sondern hat das Gesamtergebnis dort lediglich aufgeschlüsselt und Angaben zu den Beeinträchtigungen einzelner Teile des Arms gemacht. Eine 40%-ige Beeinträchtigung hat der Sachverständige ausdrücklich allein für das Schultergelenk und nicht für den gesamten Arm angenommen.
Unzutreffend ist auch die Rüge der Beklagten, der Gutachter habe vorliegend veraltete Literatur verwendet. Dass in dem vom Gutachter zitierten Standardwerk Rompe/Erlenkämper die einschlägigen Passagen inzwischen von einem anderen Autor bearbeitet werden, lässt nicht auf sachliche Fehler der Ausführungen schließen. Offen ist, wann der Nachfolger die Bearbeitung übernommen hat und ob überhaupt neue Ausführungen zu den hier einschlägigen Punkten gemacht wurden. Dass der Sachverständige nicht diejenigen Standards zitiert hat, die von dem beklagtenseits mit einer Gegenstellungnahme betrauten Kollegen erarbeitet wurden, lässt sich mit akademischer Arroganz erklären und zwingt nicht zur Annahme unzureichender Begutachtung.
Entgegen der Auffassung der Beklagten bedurfte es der ergänzenden Einholung eines neurologischen Gutachtens nicht. Beweisthema war vorliegend der Umfang der Funktionsbeeinträchtigung. Diese lässt sich chirurgisch / orthopädisch und neurologisch nur einheitlich feststellen, was durch Vertreter aller Fachrichtungen gleichermaßen möglich ist. Selbst wenn man hier anderer Ansicht sein sollte und annehmen wollte, in den jeweiligen medizinischen Teilbereichen sei eine unterschiedliche Funktionsbeeinträchtigung feststellbar, hat der Sachverständige aus seinem Fachgebiet eine Beeinträchtigung festgestellt, die als Mindestbeeinträchtigung der gerichtlichen Gesamtbetrachtung zugrunde zu legen ist. Ergäbe eine zusätzliche neurologische Begutachtung eine geringere Beeinträchtigung, könnte dies die Höhe der Entschädigung nicht reduzieren. Ob sich zugunsten des Klägers eine höhere Beeinträchtigung ergäbe, braucht in Anbetracht seines ausdrücklichen Verzichts auf ein solches weiteres Gutachten nicht untersucht zu werden.
Bei Anwendung der vereinbarten Gliedertaxe ist allein von der Position „Arm im Schultergelenk“ auszugehen. Eine zusätzliche Berücksichtigung auch der Gliedertaxenbereiche Finger, Hand oder Ellenbogen kommt nicht in Betracht.
Die Gliedertaxe stellt für den Verlust bzw. die Funktionsunfähigkeit der in ihr genannten Gliedmaßen oder deren Teilbereiche durchgängig alleine auf den Sitz der unfallbedingten Schädigung ab (BGH VersR 1991, 57 und 413; BGH VersR 2006, 1117). Mit ihren unterschiedlichen Sätzen trägt die Gliedertaxe dem Umstand Rechnung, dass Beeinträchtigungen eines Körperglieds mit zunehmender Rumpfnähe der Stelle, an der die Gebrauchsbeeinträchtigungen auslösende Ursache zu lokalisieren ist, zu wachsender Einschränkung der generellen Arbeitsfähigkeit von Menschen führen. Mit anderen Worten: Wer seinen Arm im Schultergelenk oder sein Bein über der Mitte des Oberschenkels verliert, ist wesentlich mehr beeinträchtigt als jemand, der den Arm unterhalb des Ellenbogengelenks oder das Bein bis zur Mitte des Unterschenkels verloren hat; letzterer ist wieder mehr beeinträchtigt als derjenige, der nur einzelne Zehen oder Finger bei einem Unfall eingebüßt hat. Ausweislich ihrer gestaffelten Invaliditätsprozentsätze berücksichtigt die Gliedertaxe der AUB dabei stets auch die Beeinträchtigung naturgemäß mitbetroffenen rumpffernerer Teile desselben Glieds (vgl. BGH, VersR 1990, 964; 1991, 413; 2001, 360; OLG Brandenburg, 12 U 147/04, Urteil vom 10. März 2005, Rdnr. 15 bei juris; LG Dortmund, 2 O 255/07, Urteil vom 27. September 2007, Rdnr. 13 bei juris)..
Im vorliegenden Fall ist die Schädigung des Klägers im Schultergelenk des Arms entstanden. Dass die dort verletzten Nerven zu Beeinträchtigungen auch der Unterarms und der Hand führen, ist bei Bemessung des für den gesamten Arm vereinbarten Taxwerts bereits berücksichtigt. Wenn der Kläger mit der rechten Hand nur noch bedingt greifen kann, indem er den Gegenstand zwischen Daumen und geradem Zeigefinger einklemmt, er eine Faust oder normale Greifbewegungen nicht mehr machen kann, die Sensibilität von Hand und Arm hochgradig eingeschränkt ist und insbesondere das Wärmegefühl fast völlig fehlt, so sind dies genauso Beeinträchtigungen des „Arms im Schultergelenk“ wie die dauerhaften Schmerzen und Gefühllosigkeit im rechten Unterarm und der Umstand, dass der Arm im Schultergelenk nur noch bis zu einer Höhe von 90 – 120 Grad angehoben werden kann.
Dahin stehen kann, ob eine andere Betrachtung in den Fällen des Polytraumas geboten sein kann, wenn verschiedene Verletzungen desselben Glieds vorliegen und unterschiedliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Unstreitig sind alle Beschwerden des Klägers darauf zurück zu führen, dass er sich beim Sturz von der Leiter den Arm auskugelte und dabei der Plexus brachialis verletzt wurde. Damit liegt nur ein Unfallereignis vor, das nur an einer Stelle auf den Körper des Klägers einwirkte und auch nur eine unmittelbare Schädigung verursachte.
Eine Addition der Gliedertaxeneinzelwerte für Hand, Unterarm und Schulterbereich ergibt sich entgegen der Ansicht des Klägers nicht aus der „Hand-in-Handgelenk“- (BGH VersR 2003, 1163) bzw. „Arm im Schultergelenk“-Rechtsprechung (BGH VersR 2006, 1117) des BGH. In beiden Urteilen hat der BGH lediglich festgestellt, dass die entsprechenden Formulierungen der Gliedertaxe unklar sind und zugunsten des Versicherungsnehmers unabhängig davon Anwendung finden, ob das jeweilige Gelenk (Handgelenk, Schultergelenk) oder auch der rumpffernere Teil des Körperglieds (Hand, Arm) beeinträchtigt sind. Auf diese Frage kommt es vorliegend nicht an, da die Funktionsstörungen des Klägers vom Schultergelenk bis in die Hand hinein reichen.
Eine Addition der Gliedertaxeneinzelwerte ergibt sich auch nicht aus § 7 I. (2) d) AUB 88. Nach dieser Klausel werden die Invaliditätsgrade, die sich nach der Gliedertaxe ergeben, zusammengerechnet, wenn durch den Unfall mehrere körperliche Funktionen beeinträchtigt sind.
Versicherungsbedingungen sind aus sich heraus zu interpretieren ohne vergleichende Betrachtungen mit anderen Versicherungsbedingungen, die dem Versicherungsnehmer regelmäßig nicht bekannt sind und auch nicht bekannt sein müssen, so dass ihm eine bedingungsübergreifende Würdigung deshalb von vornherein verschlossen bleibt (ständige Rechtsprechung des BGH, zuletzt Urt. vom 15.12.2010 – IV ZR 24/10; BGH VersR 2009, 1622; BGH VersR 2000, 1090). Die Entstehungsgeschichte der Bedingungen – und erst recht ihre spätere Entwicklung in nachfolgenden Fassungen – hat daher außer Betracht zu bleiben. Es geht allein darum, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer die Klausel selbst, ggf. in Verbindung mit einer Zusatzklausel, wie sie in den Besonderen Bedingungen enthalten ist, bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen muss (BGHZ 123, 83, 85 m.w.N.). Dabei sind die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit – auch – seine Interessen entscheidend.
Ein solcher Versicherungsnehmer entnimmt zunächst § 7 I (1) AUB 88, dass die Beklagte als Versicherer ihm eine Invaliditätsleistung verspricht für den Fall, dass ein Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung seiner körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) führt. Unter den in der Klausel weiter genannten Voraussetzungen entsteht ein Anspruch auf Kapitalleistung aus der für den Invaliditätsfall vereinbarten Versicherungssumme. Wie sich die Höhe der Leistung im Einzelnen bemisst, erfährt der Versicherungsnehmer aus § 7 I (2) AUB 88; danach richtet sich diese nach dem Grad der Invalidität. Unter Buchst. a werden feste Invaliditätsgrade genannt, wenn es – wie hier – zum Verlust oder zur Funktionsunfähigkeit von Körperteilen oder Sinnesorganen kommt. Das ist für den (völligen) Verlust oder die (völlige) Funktionsunfähigkeit eines Armes im Schultergelenk ein Invaliditätsgrad von 70%, wobei nach Buchst. b bei einem Teilverlust oder einer bloßen Funktionsbeeinträchtigung des betreffenden Körperteils nur ein entsprechender Teil des der Gliedertaxe zu entnehmenden Prozentsatzes in Ansatz gebracht wird.
Der Versicherungsnehmer erkennt bei Durchsicht der pauschalierten Invaliditätsgrade, dass diese auf einzelne Körperglieder abstellt und in Teilglieder aufgeschlüsselt ist. Ihm wird deutlich, dass für die Beeinträchtigung eines Körperglieds eine umso höhere Invalidität anzunehmen ist, je größer der von der Beeinträchtigung erfasste Teil des Körperglieds ist. So rechtfertigt sich eine Annahme einer 70%-igen Invalidität eines vollständigen, bis zum Schultergelenk betroffenen Arms nur, weil dadurch auch die rumpfferneren Teile des Arms (Ellenbogen, Handgelenk, Hand, Finger) in Mitleidenschaft gezogen sind.
Die in § 7 I. (2) d) AUB 88 vorgesehene Addition von Invaliditätsgraden wird der Versicherungsnehmer schon dem Wortlaut dieser Klausel folgend („mehrere Funktionen“) auf die Funktionen verschiedener Körperglieder beziehen. Ist etwa neben dem rechten Arm auch die linke Hand funktionsbeeinträchtigt, sind die Werte eines Arms (70%) und einer Hand (55%) zu addieren. Nur insoweit macht die vereinbarte Obergrenze von 100% Sinn, denn bezöge sich die Addition auf Teile desselben Glieds, müsste als Obergrenze der vereinbarte Invaliditätsgrad des vollständigen Glieds angenommen werden (für einen Arm also 70%).
Dem Versicherungsnehmer wird aus § 7 I (2) AUB 88 weiter deutlich, dass der Wert der Körperglieder sich nicht aus einer Addition des Werts aller seiner Teile ergibt (für einen Arm läge diese Summe allein bis zum Ellenbogen schon bei 225%), sondern dass zu seinen Gunsten der Verlust kleinerer Körperglieder nicht quotal auf das gesamte nicht zum Rumpf gehörende Glied bezogen wird, sondern er dafür einer überproportionale Entschädigung erhalten soll.
Diese, eine Addition nicht auf Teile des gleichen Körpergliedes erstreckende Auslegung des § 7 I (2) d) AUB 88 entspricht auch der bislang einhellig vertretenen Auffassung in Rechtsprechung und Lehre (OLG Celle Urt. vom 15.04.2010 – 8 U 205/09; OLG Köln RuS 2003, 472; Grimm, Unfallversicherung, 4. Aufl. Nr. 3 AUB 99; Prölls/Martin/Knappmann Nr. 2 AUB 2008 Rn. 41).
Vor diesem Hintergrund wird der Versicherungsnehmer § 7 I (2) AUB 88 interpretieren; für eine Mehrdeutigkeit oder eine sonstige Unklarheit im Sinne des § 305c Abs. 2 BGB ist in diesem Zusammenhang dann nichts ersichtlich.
Auch wenn damit eine rechnerische Addition von Einzeltaxwerten ausscheidet, kommt den vereinbarten Einzelwerten bei Bemessung der Teilinvalidität nach § 7 I (2) b) AUB 88 Bedeutung zu. Die für das maßgebliche körpernähere Glied ermittelte Funktionsbeeinträchtigung darf nicht hinter derjenigen zurückbleiben, die für das körperfernere Glied ermittelt wird (BGH VersR 2001, 360 f.; OLG Köln RuS 2003, 472). Soweit also die Funktionsbeeinträchtigung der Hand für sich genommen größer ist als diejenige des Unterarmes und damit schon zu einer höheren Entschädigung führen würde, wäre der Handwert maßgeblich. Dieser darf in einem solchen Fall quasi als „Untergrenze“ nicht unterschritten werden.
Im vorliegenden bedeutet dies, dass der nach § 7 I (2) b) AUB 88 für den „Arm im Schultergelenk“ festzusetzende Prozentsatz der Beeinträchtigung nicht geringer sein darf, als der Prozentsatz der Beeinträchtigung für ein Einzelglied des Arms. Der Sachverständige Dr. SV1 hat die Beeinträchtigung des Arms insgesamt mit 11/20 bewertet, was ausgehend von einem Invaliditätsgrad des Arms von 70% zu einem Anspruch aus 38,5% der Versicherungsleistung führen würde. Den Umfang der Beeinträchtigung der Hand alleine hat der Sachverständige auf 80% geschätzt, was bei einem Invaliditätsgrad der Hand von 55% der Versicherungsleitung zu einem Anspruch des Klägers in Höhe von 44% führen würde. Diese 44% stellen damit eine Untergrenze dar, die bei Bemessung der Beeinträchtigung des Arms insgesamt nicht unterschritten werden darf. Der nach § 7 I (2) b) AUB 88 festzusetzende Prozentsatz der Funktionsbeeinträchtigung des Arms muss, weil beim Kläger eben nicht nur die Hand, sondern auch weitere Teile des Arms beeinträchtigt sind, höher liegen als die Untergrenze. Die insgesamt anzusetzende Funktionsbeeinträchtigungsquote schätzt das Gericht deswegen auf 15/20 des Armwerts, d.h. 52,2% der vereinbarten Versicherungsleistung.
Hierin liegt kein Abweichen von den durch den Sachverständigen festgestellten und bewerteten Tatsachen, sondern alleine eine durch die Auslegung des § 7 I (2) AUB 88 bedingte rechtliche Korrektur. Der Senat folgt dem Sachverständigen Dr. SV1 sowohl in der Feststellung, dass aus medizinischer Sicht die Beeinträchtigung der Hand alleine mit 80% des Handwerts, die Beeinträchtigung des Arms insgesamt mit 11/20 zu bewerten ist. Alleine Rechtsgründe zwingen dazu den Armwert auf mehr als 12,5/20 festzusetzen. Zu dieser Neufestsetzung sieht sich der Senat nach den Feststellungen des Sachverständigen im Rahmen des 287 ZPO in der Lage.
Soweit der Kläger mit der Klage eine den zugesprochenen Betrag übersteigende Versicherungsleistung begehrt, ist seine Klage nach den vorstehenden Ausführungen unbegründet.
Unbegründet ist die Klage auch, soweit der Kläger Ersatz der ihm entstandenen vorgerichtlichen Kosten begehrt. Insoweit fehlt es an einer schlüssigen Darlegung, wann er seinen Rechtsanwalt zu welchen Tätigkeiten beauftragt hat. Nach Änderung der obergerichtlichen Rechtsprechung steht es dem Kläger frei, diese Ansprüche im Kostenfestsetzungsverfahren geltend zu machen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO, die Entscheidung über die Zulassung der Berufung auf § 543 ZPO.